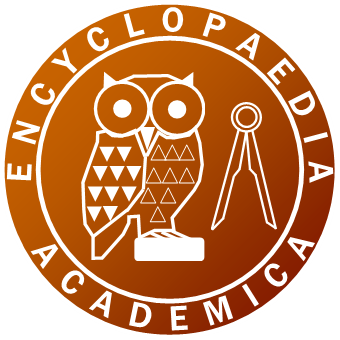Controlling
1. Begriff des Controllings
1.1 Controlling als Teilfunktion der Unternehmensführung
Controlling wird i. d. R. als eine Teilfunktion der Unternehmensführung definiert,
die gemäß des verbreiteten koordinationsorientierten Ansatzes alle
Führungsteilsysteme
durch ihre Koordination auf Unternehmensziele ausrichtet.[1]
In der Controlling-Lehre wird Controlling auf die Koordination von Planung
und Kontrolle sowie Informationsversorgung begrenzt,[2]
was die praktische Rezeption der Lehre begünstigt.[3]
Bei der Funktionserfüllung kommt dem Controlling eine beratende Rolle
im Sinne der Entscheidungsvorbereitung zu, die von der
Entscheidungsdurchsetzung getrennt ist.[4]
Obwohl Controlling demnach i. d. R. als Stabsstelle organisiert ist, werden in der
Praxis durchaus Weisungsbefugnisse an das Controlling delegiert, die i. W.
Informationsbeschaffungsrechte umfassen.[5]
Eine einheitliche wissenschaftliche und praktische Definition
der Controlling-Funktion liegt nicht vor.
1.2 Controlling als deutsche Wortverwendung
„Controlling“ findet nahezu ausschließlich in der deutschen Sprache Verwendung. Dies kann
auf eine Analogiebildung zum „Accounting“ bis
ins Jahr 1956 zurückgeführt werden, bei der
das englische Verb „(to) control“
in Anlehnung an
die amerikanische Stellenbezeichnung „Controller“
falsch
substantiviert wurde, um die Tätigkeit des Controllers in
einem Wort zusammenzufassen.[6]
Dieser „Pseudoamerikanismus“[7]
findet im internationalen Rahmen kaum Beachtung,
mit der Folge,
dass ein wissenschaftlicher Austausch mit den
angloamerikanischen Disziplinen des Managerial oder
Behavioral
Accountings, die in ihren Problemstellungen große
Gemeinsamkeiten mit dem Controlling aufweisen,[8]
behindert wird.
Ungeachtet der Wortentstehung wurde der Begriff Controlling Anfang der
1970er Jahre insbesondere durch
Albrecht Deyhle, den Gründer
der Controller Akademie geprägt.[9]
Im angloamerikanischen Raum ist am ehesten die Bezeichnung „Controllership“
mit Controlling gleichzusetzen, da die deutschen Controlling-Konzepte
eng an das Vorbild Controllership angelehnt sind.[10]
Controllership geht
von den Tätigkeiten des Controllers aus und wird daher der
institutionellen, d. h. am Akteur orientierten Sichtweise zugeordnet.
1.3
Controlling als Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre
Die Entwicklung einer Controlling-Funktion aus der Praxis heraus hat zu
der Begründung des Controllings als eine Teildisziplin der
deutschen Betriebswirtschaftslehre geführt. Den Ausgangspunkt
der
universitären Institutionalisierung markiert die 1975 erfolgte
Berufung Péter Horváths auf
den an der TH Darmstadt neu
geschaffenen Lehrstuhl für Controlling; eine
adäquate akademische Institutionalisierung des Controllings
ist im englischsprachigen Raum nicht erfolgt.[11]Während
sich die
Controlling-Lehre
insoweit an den Inhalten der Controlling-Praxis orientiert, wie
etablierte Führungsinstrumente in die Controlling-Konzeption
einbezogen werden, dominiert bei der
theoretischen Fundierung der eingangs genannte
koordinationsorientierte Ansatz,[12]
der oftmals ausdrücklich mit
dem systemtheoretischen Ansatz verbunden wird.[13]
Demnach kann „Controlling als das Subsystem der
Führung mit der
Funktion der führungsinternen ergebniszielorientierten
Koordination“[14]
definiert werden, wobei „alle
Subsysteme der Führung“[15]
einbezogen
würden. Die theoretische Fundierung und die Benennung
der in der
Koordination aller Führungsteilsysteme liegenden
Problemstellung
genügen der
Begründung einer
eigenständigen akademischen Controlling-Disziplin, sofern sie
für die Praxis relevante Forschungsergebnisse hervorbringt.[16]
Die
letzte Voraussetzung hat zu der o. g.
weiteren Begrenzung der Problemstellung auf die Koordination von
Planung und Kontrolle sowie Informationsversorgung
geführt.
2. Die Koordinationsaufgabe des Controllings am
Beispiel der Planung
2.1 Die Koordination des Planungssystems
Bei der Koordination des Planungssystems werden insbesondere die
Teilsysteme der strategischen Planung, der operativen Planung und der
Budgetierung unterschieden.[17]
Ausgangspunkt der Planung ist die Zielbestimmung, weshalb die Plankoordination mit
der Aufstellung eines widerspruchsfreien Zielsystems
anfängt.[18]
Die eigentliche Plankoordination erfolgt
einerseits sachzielorientiert, wobei die Maßnahmen der
strategischen Planung auf die operative Planungsebene heruntergebrochen
werden, andererseits erfolgt sie auch formalzielorientiert, indem
strategische Budgets mit den operativen Budgets abgestimmt werden.[19]
Da die
Koordination sowohl zwischen den Planungsteilsystemen als auch
innerhalb einzelner Planungsteilsysteme erfolgen kann,[20]
sind auch
Einzelmaßnahmen und Teilbudgets auf jeder Ebene abzustimmen.
Hinzu kommt die Abstimmung zwischen den sach- und
formalzielorientierten Plänen in Form
einer wertmäßigen Bewertung der
Planmaßnahmen, die in der Budgetierung als dem
Hauptbestandteil der formalzielorientierten Planung mündet.[21]
Das Koordinationsproblem kann beliebig
erweitert werden, falls beispielsweise Organisations- bereiche oder
Prozesse unterschieden werden, die jeweils beplant werden.
2.2 Plankoordination mit der Balanced
Scorecard
Ein herausragendes Instrument zur Koordination der strategischen mit
der
operativen Pla- nungsebene ist die Balanced Scorecard (BSC), die
gleichzeitig
die sachzielorientierte Planung mit der formalzielorientierten
verknüpft. Zum einen werden in der BSC Wechselwirkungen
zwischen den vier Perspektiven (1) Geschäftsprozesse, (2)
Lernen und Entwicklung, (3) Kunden, und (4) Finanzen aufgezeigt. [22]
Zum anderen werden je Perspektive aus der Strategie und Vision
abgeleitete Ziele formuliert, deren Umsetzung anhand von hinzutretenden
Kennzahlen, Vorgaben und Maßnahmen dokumentiert wird. Auf
diese Weise lassen sich die in der finanziellen Perspektive
abgebildeten Ergebniszielbeiträge bis auf strategiekonforme
operative Einzelmaßnahmen je Perspektive
zurückführen. Über eine systematische
Ableitung von abteilungs- oder geschäftsfeldspezifischen
Scorecards aus einer übergeordneten BSC und ihren Einsatz als
Kommunikationsinstrument kann eine Koordination zwischen Organisa-
tionsbereichen erreicht werden.[23]
|
Anmerkungen
zum Artikel
[1] Vgl. Horváth
(1998), S. 110 oder Küpper
(2005), S. 33. Horváth
beschränkt
die Unternehmensziele auf die
der Wirtschaftlichkeit dienenden Ergebnisziele; vgl. Horváth
(1998), S. 137 ff. Ossadnik
führt die
koordinationsorientierte Definition auf Horváth
(1978) zurück; vgl. Ossadnik
(2003), S.
23.
[2] Vgl. Küpper
(2005), S. 38.
[3] Horváth
u. a. sehen diesen Ansatz „im Einklang
mit der
[Controlling-]Realität“;Horváth
(1998), S. 147
[4] Vgl. Ossadnik
(2003), S. 44 f.
[5] Vgl. Ossadnik
(2003), S. 35 f.
[6] Schwarz
zitiert Ronneberger
(1956), S. 28; vgl. Schwarz
(2002), S. 52.
[7] Binder
(2006), S. 102.
[8] Vgl. Schwarz
(2002), S. 53.
[9] Vgl. Binder
(2006), S. 102..
[10] Vgl. Schwarz
(2002), S. 53.
[11] Vgl. Küpper
(2005), S. 47 ff.
[12] Andere, neuere
Ansätze sind z. B. der Informationsökonomische Ansatz
oder der Ansatz der Rationalitätssicherung der
Führung bei Weber
(2006).
[13] So z. B. bei Horváth
(1998), S. 91, Schwarz
(2002), S. 64 oder Ziegenbein
(2007), S. 22; vgl. Horváth
(1998), S.
147.
[14] Horváth
(1998), S. 110.
[15] Horváth
(1998), S. 119.
[16] Vgl. Küpper
(2005), S. 7.
[17] Vgl. Horváth
(2006)
, S. 211 f.
[18] Vgl. Küpper
(2005), Seitenangabe
folgt noch.
[19] Horváth
sieht in der Unterscheidung der sachziel- und formalzielorientierten
Planung eine wesentliche Differenzierung der Planung; vgl. Horváth
(2006), S. 173.
[20] Vgl. Küpper
(2005), S. 36.
[21] Vgl. Horváth
(2006), S. 212 f.
[22] Vgl. Horváths
aus dem Amerikanischen übersetzte Darstellung des Ansatzes von
R. S. Kaplan und D. P. Norton
in Horváth
(2006), S.245.
[23] Vgl. Horváth
(2006), S. 245. |